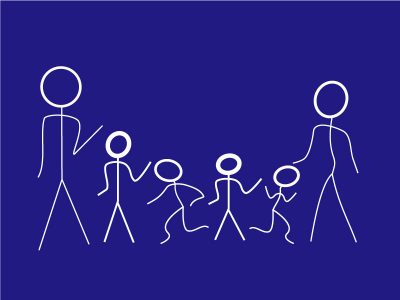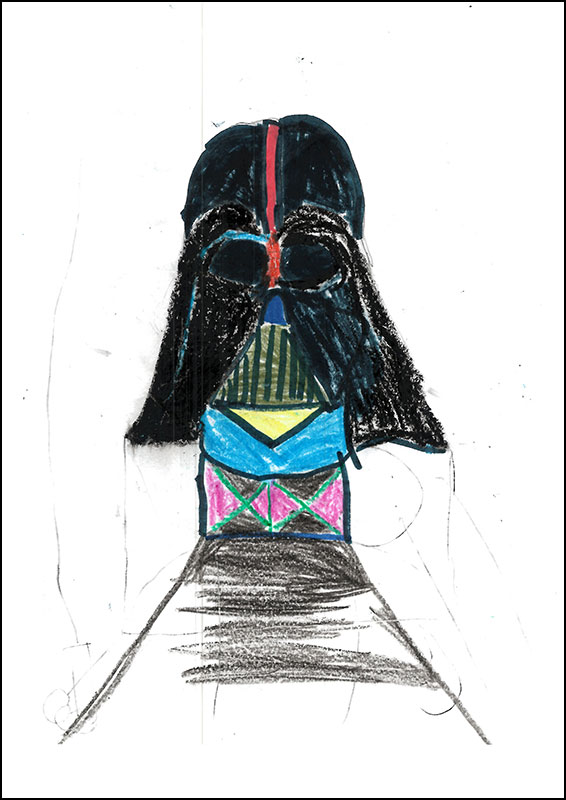Wie New Jersey seinem Beinamen „The Garden State“ alle Ehre macht. Warum Montessori hier zwar heißt „Hilf mir, es selbst zu tun“, aber eben auch „Bewege dich wenig und sei nicht allzu kreativ“. Und wie die Bilanz der ersten drei Monate nach unserem „JUMP“ ins kalte USA-Wasser ausfällt.
Unsere Lindt-Osterhasen hatten als deutsche Schokohasen hier in New Jersey schon ein aufregendes Leben: Zunächst wurden ihnen die Glöckchen wegen der erwähnten „Verschluckungsgefahr“ geklaut und dann mussten sie auch noch über 30 Grad aushalten. Sie waren trotzdem lecker und die Kids haben sowohl die Häschen als auch das Wetter genossen. So haben wir schon früh im Jahr einen kleinen Vorgeschmack auf die Temperaturen im hiesigen Sommer bekommen – puh, das kann ja heiß werden …
Überall bunte Gute-Laune-Inseln
Aber die erste Hitzewelle ist jetzt erst mal vorbei. Zurzeit genießen wir herrliche Frühlingstemperaturen und staunen über die farbenfrohe Blütenpracht, die sich mit aller Macht jeden Tag mehr und überall entfaltet. Besonders die üppigen Magnolien und leuchtend gelben Forsythien verbreiten gute Laune. Für mich waren sie richtige kleine Erholungsinseln auf meinen „Taxidiensten“ zur preschool.
Um diese Jahreszeit bekommt der Beiname von New Jersey als „The Garden State“ tatsächlich eine Bedeutung. Woher dieser Spitzname stammt – der übrigens auch auf unseren Auto-Nummernschildern steht – ist historisch nicht eindeutig geklärt. Aber es gibt hier im Süden außer den erwähnten Blumen und blühenden Sträuchern tatsächlich sehr viele Obst- und Gemüsefarmen. Der Norden New Jerseys ist allerdings eher industriell geprägt.
Los geht’s: Es ist soweit – It´s spring clean time!
Ganz Morristown macht jetzt großen Frühjahrsputz – überall wird frischer Rasen gesät und sorgfältig mit Stroh abgedeckt, die letzten Laubreste vom Vorjahr verschwinden und Freiwillige sammeln fleißig Müll in Stadt und Umgebung. Hut ab – alles ist jetzt „spring-cleaned“ und überall spürt man Aufbruchsstimmung. Auf den großen Sportplätzen sieht man immer mehr Leute, die Sport machen, die Grillsaison ist eröffnet und neben Mückenschutz-Kerzen gibt es jetzt an jeder Ecke die „Stars and Stripes“ (US-Flagge) zu kaufen.
Und während Morristown in neuem Glanz erstrahlt, gibt es ganz woanders im Moment richtig dicke Luft: Der Vulkan Ejafjallajökull auf Island spukt im Moment so viel Vulkanasche, dass der Flugverkehr in weiten Teilen Nord- und Mitteleuropas diesen Monat zeitweise eingestellt ist – Marcs Kolleginnen und Kollegen können daher nicht zum Meeting nach Morristown fliegen. Das Wall Street Journal titelt: „Volcanic cloud keeps fliers grounded – turning airports into hostels”.
Specht gegen Rasenmäher
Bei uns im Garten hämmert der Specht jeden Vormittag unbeeindruckt gegen die Armada von motorisierten Gartengeräten an, die die Grundstücke der Nachbarschaft wieder auf Vordermann bringt. Auch in unserem Vorgarten stand eines Samstags plötzlich eine Horde Männer, die fleißig Herbizide und Pestizide versprühte – damit sind die hier nicht zimperlich. Ich konnte gerade noch Schlimmeres im Garten hinter unserem Haus (backyard – verrückt „front yard“ schreibt man getrennt, „backyard“ tatsächlich zusammen) verhindern.
Viele Väter, viele Kinder
Die Spielplätze füllen sich und vor allem am Wochenende sieht man sehr, sehr viele Väter, die sich um ihren Nachwuchs kümmern – genau wie beim Eltern-Kind-Turnen von Ole (4) und Paul (3) im YMCA, bei dem ich tatsächlich schon öfter die einzige Frau in der Halle war. Außerdem scheinen wir hier in einer sehr fruchtbaren Gegend zu leben, denn es gibt viel mehr Geschwister-Kinderwagen (mit Sitzplätzen für zwei Kinder) als in Deutschland.
Ein Blick auf die Statistik bestätigt meinen Eindruck aus dem Alltag: Während wir in Deutschland durchschnittlich weniger als anderthalb Kinder pro Frau haben, sind es in den USA über zwei Kinder. Das fällt sofort auf und diese Tendenz scheint quer durch alle ethnischen Gruppen zu gehen.
Unser April
Die letzten Wochen waren wieder ziemlich anstrengend – das Wort „Routine“ im letzten Brief habe ich wohl etwas vorschnell benutzt:
- Wir sind wieder ohne Hilfe im Haus. Die Folge: Ich bin ganz schön am Rotieren.
- Seit einer Woche machen wir unseren zweiten Versuch mit einer neuen Kinderfrau: Sie heißt Duaa, kommt aus dem Sudan und lebt seit zehn Jahren in Amerika. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir mit einer Nicht-Amerikanerin bessere Aussicht auf Erfolg haben.
- Die Schule bei Theo (7) und Tim (6) läuft soweit gut.
- Wir haben eine neue preschool für Ole (4) gefunden und Paul (3) geht direkt auch mit.
- Marcs derzeitiger Job: Reisen quer durch die USA.
- Mein derzeitiger Job: Kinder Hin- und Herfahren und immer mit dem Handy auf Abruf stehen.
Montessori heißt hier auch Disziplin
Zunächst die positive Nachricht: Der neue Montessori-Kindergarten (also die preschool) von Ole und Paul ist um Lichtjahre besser als die erste preschool. Sie hat viele Vorzüge:
- Die „Hauptlehrerin“ (the head teacher) Mrs Rossi: mit Leib und Seele dabei und lässt sich von Ole auch mal ganz feste drücken.
- Die anderen Kids: erfrischend locker und sehr hilfsbereit.
- Das Montessori-Material: Super. Ole und Paul sind beim „Arbeiten“ (sie sprechen hier von „work“) oft völlig vertieft.
preschool mit Betonung auf school
Jetzt leider die negative Nachricht: Der kindergarten ist eben kein „Kinder“garten, sondern eine unverkennbar amerikanische preschool und unsere Kinder verhalten sich auch nach drei Monaten immer noch ziemlich deutsch: Jeden Morgen erregen wir Aufsehen, wenn Ole nicht mit seiner „inside voice“ – also leise – spricht, sondern laut ruft, und Paul nicht mit „walking feet“ – also langsam – den Raum betritt, sondern eher hereinstürmt.
- Die Kids lernen Zahlen und Buchstaben, Schreiben und erstes Rechnen – selbst die Jüngsten müssen zuerst ihren Namen oder Anfangsbuchstaben auf das Blatt „schreiben“, bevor sie losmalen dürfen.
- Es herrscht absolute Disziplin: Gerenne, Geschubse, lautes Reden und Drängeln sind tabu.
- Absolut keine Toleranz – zero-tolerance policy – bei körperlichen Auseinandersetzungen. Wer haut und schlägt, für den heißt es: ab nach Hause!
Wie gut, dass Ole und Paul sich gegenseitig zum Knuffen und Kneifen haben! Und weil sie Geschwister sind, sehen sie es dann nicht so eng … - Viele Kinder sitzen in einem kleinen Raum (in „unserer“ Gruppe sind 25 Kids).
- Sie haben kaum Bewegung – drei Stunden heißt es am Platz arbeiten, erst dann 20 Minuten raus, ganz zum Schluss.
- Es gibt nur einen kleinen, sehr sterilen Spielplatz ohne Sand. Stattdessen liegen „woodchips“, eine Art Rindenmulch, unter den Geräten. Ist grässlich und stinkt schimmelig …
- Hausschuhe und Buddelsachen gibt es gar nicht.
- Außerdem herrscht eine übertrieben penible Hygiene: Nach dem Händewaschen müssen die Kinder auch noch Desinfektionsspray benutzen!
Eins ist immerhin tröstlich: Es gibt Tageslicht im Klassenraum! Viele der anderen preschools, die ich mir angeguckt habe, liegen tatsächlich im Keller von Kirchen – entweder mit Kellerfenstern oder sogar nur mit künstlicher Beleuchtung. Das scheint hier ziemlich verbreitet und vollkommen akzeptiert zu sein.
Mein aktuelles Grübelthema: Kindererziehung
Was mich diesen Monat besonders umtreibt, sind vor allem die Unterschiede in der Kindererziehung, die sich immer klarer im Alltag zeigen und für mich oftmals sehr widersprüchlich sind.
- Eine gängige Regel: Eltern sollten ihre Kids bis zum Alter von zwölf Jahren nicht alleine zuhause lassen – ein beliebtes Thema unter den deutschen Expats. Es gibt zwar nur in wenigen Staaten wirklich entsprechende Gesetze wie z. B. in Maryland (bis 8) und in Illinois (bis 14), aber die Altersgrenze von zwölf Jahren geistert hier trotzdem überall herum. Sie wird von der Organisation „Safe Kids“ national empfohlen und von Eltern, Erzieher/innen und Lehrer/innen als inoffizielle guideline akzeptiert.
- „Playdates“, also Verabredungen zum Spielen, machen nicht die Kinder, sondern die Eltern – selbst in Theos Alter (und Theo ist 7!).
- Kleine Kinder dürfen sich keine zwei Meter von den Eltern entfernen, sonst wird man – wie ich neulich – angehupt. Und Paul lief gerade mal drei Meter vor mir auf dem Bürgersteig! Oder aber man bekommt böse Blicke und spitze Kommentare („He was walking down the driveway (Einfahrt) all by himself!“ Ja, mein Gott, aber ich hatte doch alles im Blick! Auch unsere Nachbarin klingelte verstört an der Haustüre, als Paul auf unserer Einfahrt mit Kreide malte, ohne dass ich direkt neben ihm stand!
- Schulweg? Nur mit den Eltern. Es gibt eine lückenlose Begleitung zur Schule und wieder zurück, Theo und Tim dürfen morgens noch nicht mal allein über unsere Straße zum bus stop gehen und dort allein warten. Ich muss die ganze Zeit mit dabei sein. Und so stehen sich häufig morgens vier Eltern gemeinsam die Beine in den Bauch, bis der Schulbus kommt – kann man das nicht besser verteilen?
- Es gibt kaum Zugang zu „gefährlichen“ Gegenständen – auch jetzt gerade wieder bei Theos science-project-Anweisungen: Nichts mit Feuer, Glas oder spitzen Gegenständen!
Andererseits …
… übertragen Eltern und Pädagog/innen viele Einstellungen aus der Erwachsenenwelt auf die Kinder:
- Zum Beispiel diese Einstellung in der preschool: „It’s not about having fun, it’s about learning and working“ (O-Ton einer der Erzieherinnen).
- Es gibt einige bierernste Erzieherinnen, die ich gerne einmal durchschütteln und ihnen sagen möchte: „Hey, das sind noch Kinder und keine zu klein geratenen Erwachsenen!“ Es sind aber nicht alle so!
- Für Schulkinder sind diese langen Schultage (8.50 a.m. bis 3.15 p.m.) mit anschließenden Hausaufgaben völlig normal. Es ist so, wie mir eine amerikanische Fußball-Mutter (bei Tims Training) erklärte: „We here in USA live to work, you in Europe work to live!“ Und an diese Lebenseinstellung werden hier schon die Dreijährigen herangeführt!
- Die Kinder reden die Lehrerinnen mit Nachnamen an, d. h. sie „siezen“ sie, während sich sonst alle Welt hier mit Vornamen anspricht, was auch oft für Arbeitnehmer/innen und ihre Vorgesetzte gilt (also genau umgekehrt wie in Deutschland).
- Das Fernsehen ist gnadenlos immer präsent – egal ob im Wartezimmer beim Kinderarzt, beim YMCA oder im babysitting-Raum in meinem Fitnessstudio – ständige laute, bunte und anstrengende Berieselung mit vollkommen dämlichem Kinderprogramm. Die amerikanischen DVDs, die wir bisher gekauft haben, haben meist „auto-play“ und „play continuously“ als Normfunktion eingespeichert – wie praktisch für die Eltern. Über das, was in amerikanischen Familien zuhause so abläuft, kann ich (noch) nichts sagen. Jane (unsere amerikanische Ex-Babysitterin) fand „Star Wars“ für Theo und Tim jedenfalls völlig okay und konnte überhaupt nicht verstehen, dass ich das anders sehe („Oh, it’s just a film!“). Aber ihren 17-jährigen Sohn wollte sie nicht eine Minute mit der deutschen Austauschschülerin alleine lassen („you know – they could …“) … ja was denn? Glaubt sie ehrlich, dass die beiden ohne ihre Aufsicht übereinander herfallen??? – Eine im wahrsten Sinn ver-rückte Denkweise, die mir sowas von fremd ist …
- Kurios: Babys und Kinder werden schon in jungen Jahren abgehärtet: Sobald der letzte Schnee weggeschmolzen ist, laufen sie bei Sonnenschein auch bei normalen Frühlingstemperaturen (10-15 Grad) nur noch barfuß, in Shorts und T-Shirts herum. Auch die Kleinsten strecken einem ihre nackten Minifüße entgegen, die Mamas tragen dagegen noch ihre Fleecejacken! Kinder anderer Nationalitäten erkenne ich im Kindergarten tatsächlich an der wärmeren Kleidung.
Soweit die kleine Zusammenfassung meines momentanen Eindrucks von preschool und Kindererziehung – gewöhnungsbedürftig und in einigen Punkten nicht das, was ich mir für unsere Kinder wünsche. Aber ich versuche, das alles nicht zu nah an mich heranzulassen, Ole und Paul zu unterstützen und es mit Humor zu sehen, wenn mir eine der älteren Lehrerinnen beim Abholen mit Grabesmiene erzählt: „Paul and Ole didn’t do well in music“ – und das nur, weil Ole nicht mitmachen wollte und Paul mal wieder eher free-style getanzt hat 🙂 .
Vom Sprung ins kalte amerikanische Wasser
Nach unseren ersten drei Monaten bietet es sich an, einmal Bilanz zu ziehen, wo wir nach unserem „JUMP“ stehen – auch in Bezug auf die Auseinandersetzung mit der neuen Sprache. Und da ja bekanntlich jedes Kind anders ist, gibt es auch bei unseren eine ganze Bandbreite von Reaktionen:
Theo (7), der am meisten Angst vor dem Sprung hatte, ist sofort losgeschwommen und hat die Veränderungen sehr gelassen genommen.
Für Tim (6) war das Wasser ja zunächst sehr kalt, vom deutschen Kindergarten in den Sechs-Stunden-Alltag der Schule plus Hausaufgaben. Die ersten Wochen gab es viele Tränen, aber inzwischen hüpft er morgens gut gelaunt mit Theo in den Schulbus.
In Bezug auf ihren Spracherwerb gilt für die beiden, was uns seit Wochen alle erzählen: „Kids are like little sponges – they pick it up so quickly“. Theo benutzt Englisch ohne Scheu, und er kann sich schon bequem verständigen (u. a. mit Vergangenheit, Komparativ, Verneinung). Marc und ich waren vollkommen überrascht, als wir ihn mit Duaa, unserer Babysitterin, reden hörten – zuhause reden wir ja miteinander sonst nur Deutsch. Jedenfalls müssen Marc und ich uns jetzt eine neue „Geheimsprache“ suchen, wenn wir im Beisein der Kinder über Dinge reden, die nicht für ihre Ohren bestimmt sind. Tim ist noch zurückhaltender und er benutzt vor allem Phrasen, die er anscheinend wie „Wörter“ lernt (sprich [ˌhauˈɑːjə] = How are you?).
Auch in der Schule ist bei Theo und Tim alles im grünen Bereich, und ihre Lehrkräfte haben sich beim ersten Elternsprechtag sehr zufrieden geäußert. Beide genießen ihr Wochenende – dann haben sie endlich Zeit zum Spielen und bauen stundenlang mit Lego sehr kreative Erfindungen. Als „science project“ tüftelt Theo z. B. gerade an einer Morsemaschine aus Lego mit Fishertechnik-Motor. Tim spielt seit drei Wochen jeden Donnerstag Fußball mit seinem Freund Justus.
Ole (fast 5) dagegen hat seine Orientierung noch nicht wiedergefunden. Er brauchte schon immer Routine, damit er sich sicher und wohl fühlt. Selbst kleinere Veränderungen wie z. B. ein neuer Pullover, konnten ihn schnell aus der Fassung bringen. Das gilt jetzt noch mehr. Er sagt ganz oft, dass er zurück nach Deutschland möchte und begründet es damit, dass „ich sonst immer jammere, weil ich keine Geduld habe“ (O-Ton Ole). Er braucht mehr Zeit, um Zugang zum Englischen zu finden. Er zupft mich den ganzen Tag am Ärmel und fragt: „Was sagen die? Was hat die gesagt?“ Das tut mir schon leid. Er vermisst seinen deutschen Kindergarten, wo er sich frei bewegen konnte. Seine Versuche, sich mit Eimer und Schaufel am Baseball-Feld zu schaffen zu machen (der einzige Ort, wo man hier Sand finden kann) sind bisher auf wenig Gegenliebe gestoßen. Wir tun alles, um ihm zu Hause Stabilität zu geben – es gibt viele Kuschelduschen, fast jeden Tag Kartoffelpüree mit Fischstäbchen, und seit kurzem haben wir ein großes Trampolin und einen kleinen Sandkasten im Garten – beides große Renner und ein bisschen Heimat.
Paul (gerade 3 geworden) hingegen ist total „laid back“, wie man hier so schön sagt. Ihn lässt das alles kalt und er ist, wie er immer ist – verschmitzt und sehr positiv. Er nimmt, was kommt – egal ob Englisch oder Deutsch – und fragt bisher nie nach Übersetzungen wie die anderen Jungs. Er ist anpassungsfähig in der preschool und hat sich in den letzten Wochen dort zu einem richtigen Montessori-Kind gemausert, das seine „Arbeit“ auswählt, sie an den Tisch bringt, arbeitet und wieder ordentlich zurückstellt. Beim potty-training zeigt er (leider) genau die gleiche Gelassenheit (er macht einfach weiter in die Hose 🙂 ), aber wir freuen uns über jeden kleinen Fortschritt, und unsere mobile Toilette im Kofferraum motiviert ihn doch ziemlich („nein, nicht das Töpfchen, ich will auch die Flasche“). Sein Lieblingsspruch: „Criss cross – applesauce“ (auf Deutsch „Schneidersitz“) – so sitzen alle Kinder im Morgenkreis.
Entenmutter
Ich fühle mich im Moment wie eine Entenmutter, die ihre Küken in unbekannte Gewässer geführt hat und nun einige Mühen hat, sie da durchzuschleusen und aufzupassen, dass keiner abtaucht. Manchmal steht mir das Wasser auch bis zum Hals (manchmal sogar drüber) und abends klingeln mir die Ohren, wenn die vier ihrem vormittags unterdrückten Mitteilungsbedürfnis dann nachmittags auf Deutsch freien Lauf lassen. Ole und Pauls „Warum?-Phase“ verschärft die Sache noch.
Ich genieße die kleinen Freiräume, die sich so langsam durch preschool und Duaa ergeben und versuche dann auch ein bisschen am „Sprachbad“ teilzuhaben. Aber ich vermisse meine Arbeit als Lehrerin und meine Schulkinder. Und dann lebe ich im Moment als einzige in der Familie in einer überwiegend deutschen Sprachumgebung – schon ein bisschen ironisch als Englischlehrerin. Aber das wird sich bestimmt noch ändern – nur Geduld!
KEEP TALKING (2) – Drei Monate USA
Wie es sich anhört, wenn Ole deutsche Wörter englisch ausspricht und was unsere Jungs mit dem „th“ anstellen. Und warum sich das Wort „looking“ auch nach drei Monaten USA immer noch hartnäckig hält.
Die Kinder lernen übrigens nicht nur Englisch, sondern auch ihr Deutsch verändert sich – es herrscht reger (Laut-)Austausch zwischen beiden Sprachen. Vor lauter „th“ haben Theo (7) und Tim (6) auch im Deutschen beide wieder angefangen zu lispeln (nach anderthalb Jahren Logopädie zuhause!) – da wachsen mir graue Haare … Inzwischen fangen sie aber im Englischen an, zwischen „th“- und „s“-Wörtern zu unterscheiden. Und Ole (4) beginnt, Vokale im Deutschen englisch auszusprechen (z. B. oben wie [əʊbn] oder unten wie [ɑntn] und das deutsche „W“ wie ein englisches [w] wie in „water“. Paul (3) redet bisher noch ganz wenig, aber er hat auch schon einen Trick raus: Statt stimmlosem „th“ (wie z. B. in „think“, oder „three“) benutzt er eine Art stimmloses [f] (obere Schneidezähnen auf die Unterlippe setzen) – hört sich gar nicht mal so schlecht an. Jedenfalls besser, als es durch ein stimmloses „s“ zu ersetzen (wie viele Deutsche es machen, die kein „th“ aussprechen können). Probiert es doch mal mit dem Wort „think“ aus: wie Paul [fɪŋk] (wie ein Häschen) oder [sɪŋk]. Na, was hört sich mehr nach „think“ an?
Die Floskel „looking“ hält sich übrigens weiter hartnäckig in unserem Haus. Abgesehen von Theo, der es sehr schnell nicht mehr genutzt hat, ist es den Kindern nicht auszutreiben, auch wenn Duaa, unsere Hilfe, und ich inzwischen immer sofort zu „look“ verbessern. Wahrscheinlich erfüllt es einfach seinen Zweck – nämlich Kontakt aufzunehmen und die Aufmerksamkeit der anderen Person zu bekommen. Na bitte, funktioniert doch! Wieso also ändern?
P3 in den USA
Marc erzählt:
Britta hat mir erzählt, dass es vielleicht auch erwähnenswert ist, wie sich das Geschäftsleben in den USA vom Business in Deutschland unterscheidet. Nachdem ich im letzten Jahr wochenweise gependelt bin und die Grundlagen gelegt habe, sind wir jetzt seit Ende Januar wirklich „feet on the ground“, also nach ziemlich genau drei Monaten.
In dieser Zeit haben wir ein heftiges Pensum absolviert: Büro gefunden (keine 500 Meter von zuhause), renovieren lassen, IT installiert, Büromöbel gekauft, Leute eingestellt (wir sind jetzt zwölf) und vieles mehr. Die Arbeitsbelastung ist echt groß, weil – anders als in Deutschland – die Infrastruktur noch nicht da ist: kein Backoffice, keine Buchhaltung, keine IT.
Wir arbeiten eng mit Deutschland und unseren Kollegen von P3 North America (Automotive) in Detroit zusammen, aber im Endeffekt mache ich CEO, CTO, CFO und was sonst noch alles gleichzeitig. Hinzu kommt mein eigentlicher Job, das business development. Das ergibt dann auch schon mal vier 20+ Stunden Tage nacheinander. Resultat: ein erhebliches Schlafbedürfnis am Wochenende. 🙂
Viele Kunden in Sicht
Aber das Geschäft läuft gut an. Unser Hauptkunde Verizon Wireless (DER Mobilfunkbetreiber in den USA) mag uns und weitet sein Geschäft mit uns aus. Wir haben mittlerweile weitere wichtige Kunden gewinnen können, die ich aber nicht alle nennen darf. Meine Tagesreisen führen mich jetzt nach Toronto, Chicago, Dallas oder Kansas City. Da der Flughafen Newark zwar perfekte Verbindungen hat, aber recht teuer ist, fliege ich häufig auch ab La Guardia oder sogar Philadelphia. Allerdings bedeutet ein Abflug um 6 a.m. auch Aufstehen um zwei Uhr morgens. 🙁
Die Sprache ist überhaupt kein Problem. Die Leute halten mich in der Regel zumeist für einen Südafrikaner oder (seltener) Schweden (warum auch immer), und ich lache mich vor allem über den Slang (‚red tape’) kaputt.
Kündigungs- und Zahlprocedere
Einige Worte zu den Unterschieden im „Corporate America“ verglichen mit Deutschland: Die Leute sind viel mobiler und das ist nicht immer gut. Da der Arbeitsmarkt viel durchlässiger ist, kann ich innerhalb von zwei Wochen jemanden feuern. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert: Wenn jemand Mist baut und man dann ein paar ernste Worte mit ihm redet, oder wenn ein Mitarbeiter auch nur ein bisschen stärker belastet wird, können die Leute ganz schnell weg sein. Ich habe mittlerweile fünf Leute verloren, in deren Training ich bereits investiert hatte. Das muss man erst einmal verstehen und sich dann ganz andere Mechanismen ausdenken, um die Leute in der Firma zu halten. Unsere Führungsmannschaft macht aber einen sehr guten Eindruck (Ron in New York, John in North Carolina, Wells in San Francisco und Moe in Los Angeles) und es macht Spaß, mit den Kollegen zusammenzuarbeiten.
Ein anderer Unterschied ist, dass eine Firma ohne credit history (wie wir hier) extremen Wert darauf legen muss, absolut pünktlich zu zahlen und so eine blütenreine Historie aufzubauen, um dann nach zwei, drei Jahren auf einmal mit ‚credit’ überschwemmt zu werden.
Spagat Job-Familie
Alles in allem muss ich sagen, dass es eine extreme Herausforderung und anstrengender ist, als ich erwartet habe. Auch der Spagat mit den familiären Herausforderungen ist manchmal heftig. Auf der anderen Seite macht es sehr viel Spaß und man lernt wahnsinnig viel in einem riesigen Markt, der für uns absolut neu ist. Trotz der hohen Belastung fühle ich mich der Aufgabe aber gewachsen. Meine Partner in Deutschland machen einen Super-Job, unterstützen mich und bauen das Geschäft in Europa weiter aus, so dass wir wirklich zu einem internationalen Unternehmen werden.
Ausblick auf den Wonnemonat Mai
- Weiter Ole unterstützen, damit er – wie die anderen – bald auch richtig hier landet.
- Am 16. Mai ist AIDS-Walkathon – und ich laufe die zehn Kilometer mit! Alle, die mich sponsern, unterstützen die AIDS-Forschung – das ist mein Trostpflaster, weil ich kein Glück bei meiner Bewerbung für den NYC-Marathon hatte (ich musste das einfach probieren und gebe nicht so schnell auf 🙂 ).
- Übrigens sind die Leute hier doch nicht ganz so prüde, wie ich dachte – viele Männer sind im Moment oft „oben ohne“ („topless“) unterwegs und die Frauen laufen in sehr knappen Tops und sehr, sehr kurzen Röckchen herum (wohl aber mit „Sporthose“ drunter) – es gibt also genug zu gucken und der Sommer scheint vielversprechend zu werden 😉 .

PS: Hier geht’s weiter zum nächsten Monatsbrief. Viel Spaß beim Lesen!